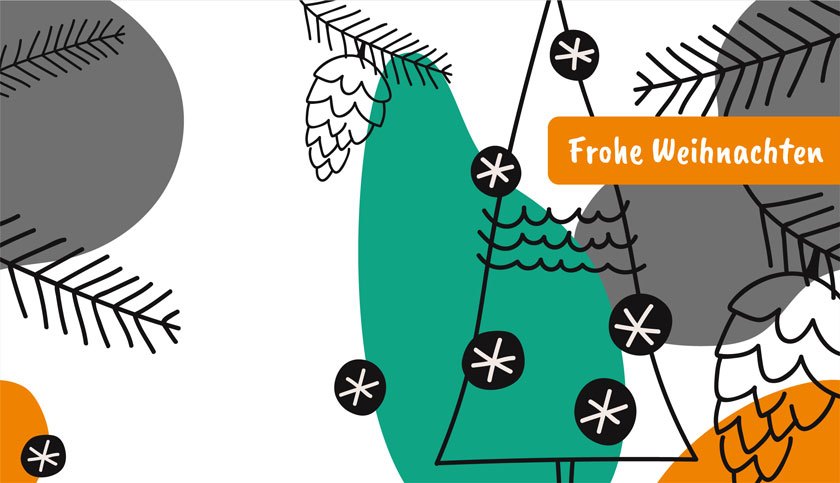News & Blog
26. April 2023
Katharina Lorenz
Auch 2023 haben wir als Arbeitgeber ein weiteres Mal gleich zwei Auszeichnungen erhalten: „Top-Arbeitgeber im Mittelstand“ und „Top Company“.
15. Dezember 2022
Katharina Lorenz
Es weihnachtet sehr bei Seven2one. Stimmen Sie sich hier mit uns auf die Feiertage ein.
5. Dezember 2022
Katharina Lorenz
Am 15. November 2022 wurde Dr. Joachim Wittinghofer zum Co-Geschäftsführer von der Seven2one Informationssysteme GmbH bestellt. Mit dieser neuen Doppelspitze in der Geschäftsleitung setzen wir unseren Erfolgskurs fort und unterstützen unsere Kunden weiterhin dabei, die Herausforderungen der Digitalisierung hin zum neuen Energiesystem zu meistern.
24. Oktober 2022
Katharina Lorenz
Energiespeicher spielen bei der Energiewende eine zentrale Rolle. Meist denkt man dabei an klassische Stromspeicher, aber auch Wärmeversorgungsanlagen werden längst genutzt, um thermische Energie zu speichern. Bisher ungenutzt sind dagegen die thermischen Kapazitäten von Kälteanlagen. Ihr Potenzial zu erschließen ist Ziel des Projekts FlexKälte.
13. Oktober 2022
Katharina Lorenz
Während der Arbeit das E-Auto mit Sonnenstrom des Gewerbeparks laden, zu Hause das Firmenfahrzeug an die Wallbox hängen – und abgerechnet wird alles vollautomatisch über den Arbeitgeber. Dahinter steckt ein komplexes System, das noch viel mehr kann. Sein Name: DualCharge.
12. September 2022
Katharina Lorenz
Manchmal ist ein IT-Thema plötzlich als Neuigkeit in aller Munde, obwohl sie eigentlich schon weit verbreitet ist. Aktuell ist es mit Kubernetes so. Kubernetes macht eine neue Struktur von Plattformen möglich und hat Seven2one so überzeugt, dass auch unsere neue Plattformlösung darauf basiert.
Sie wollen nichts mehr verpassen?
Jetzt zum Newsletter anmelden